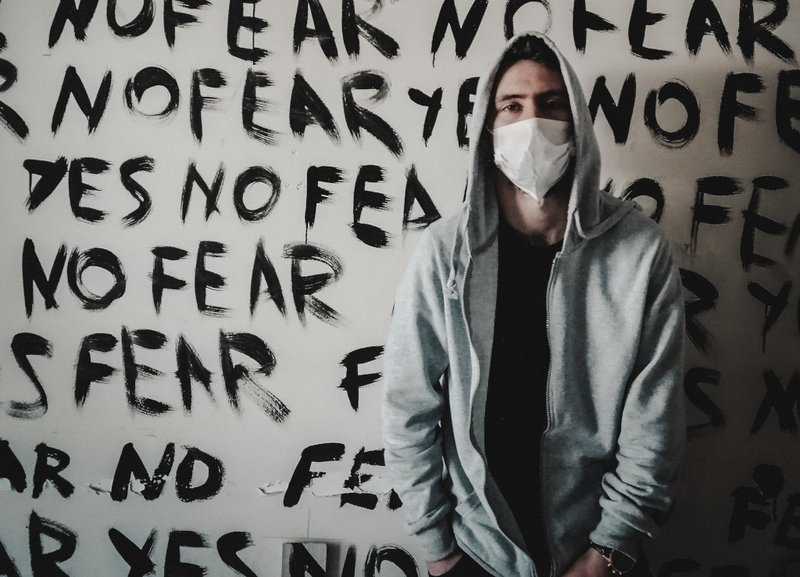„Die Heimat ist Fremde geworden, aber die Fremde nicht Heimat.“
Der Rote Faden
Von Rolf Mackowiak
Fremdheit
Wir bewegen uns täglich im Vertrauten. Wenn mir etwas Unvertrautes begegnet, muß das nichts Fremdes sein, es ist mir nur ungewohnt. Auch das Vertraute kann befremden, wenn es in einem anderen Kontext auftaucht. Als Beispiel dafür sehe ich ein Objekt, das von Meret Oppenheim stammt. Sie hat eine Tasse, Untertasse und den Löffel mit Pelz bezogen. Es ist unschwer zu erkennen, worum es sich handelt: ein Kaffee-Gedeck – allerdings im Wintermantel.
Es gibt auch Situtationen, in denen ich mich selbst fremd fühle, also nicht zugehörig. Ich muß mich dafür nicht in der Gesellschaft von Unbekannten befinden. Das Gefühl kann dadurch sogar intensiver empfunden werden, weil es mir in einem vertrauten gesellschaftlichen Rahmen begegnet. Wenn ich dagegen mit dem Bus fahre, begegne ich selten Menschen, die ich kenne, ohne daß mir diese Unbekannten als fremd erscheinen.
Fremdheit kann sich auch verlieren. Die Kartoffel ist ein Immigrant aus Südamerika, für den Mais gilt dasselbe. Fremd sind sie uns nicht mehr. Dafür wurde die Rauke als Rucola sprachlich expatriiert. Ein ähnliches Phänomen traf das Wort „manuell“, das dann als „händisch“ zu einer meiner Meinung sehr sperrigen und überflüssigen Rückübersetzung des gängigen Fremdwortes geriet.
Die Hautfarbe ist ein Unterscheidungsmerkmal, an dem wir Fremdheit bei Menschen oft festmachen. Dabei ist das kaum zu begründen. Die genetischen Unterschiede innerhalb einer Bevölkerungsgruppe können größer sein als die zu einer anderen. Als ich das in einem Bericht hörte, hat es mich ebenfalls verblüfft. Aber nichts kann so überraschend sein wie die Realität.
Mir ist das neulich sichtbar geworden. Ich schaute auf meine Fensterbank, die sich etwa auf Augenhöhe befand, als ich auf der Couch saß und mir fiel ein Gegenstand auf, den ich zuerst nicht einordnen konnte. Ich grübelte nach, was ich denn darauf abgelegt hatte und nach einiger Zeit fiel mir ein, daß es sich nur um meine Schere handeln konnte – von der Schmalseite aus betrachtet. Aber aus dieser ungewohnten Perspektive wirkte sie einfach nur fremd und ich habe sie nicht auf Anhieb erkannt.
Die Fremde hat ja etwas Ambivalentes: Sie kann einerseits Sehnsuchtsort sein, aber die Fremde kann auch als bedrohlich wahrgenommen werden. Als exotisches Urlaubsparadies ist uns die Fremde beinahe vertraut. Ganz anders war die Situation für die Menschen, die in den 30er Jahren vor dem Nationalsozialismus fliehen mußten, um ihr Leben zu retten. Einen Satz verbinde ich sehr direkt mit dieser Situation: „Die Heimat ist Fremde geworden, aber die Fremde nicht Heimat.“
Wenn aber die Fremde in Form von Menschen zu uns kommt, kann dies als bedrohlich wahrgenommen werden. Ich kann das nur sehr bedingt verstehen, und als vor einigen Jahren in Sachsen-Anhalt die AfD auf Anhieb über 20% der Stimmen in der Landtagswahl errang, fand ich das sehr schockierend. Schließlich beträgt der Ausländeranteil an der Bevölkerung nur etwa 2%. Da sind mir diese Deutschen mindestens so fremd wie irgendein Ausländer.
Ein weiterer Satz, der mir dazu einfällt, habe ich vor ewigen Zeiten als Grafitti gesehen: „Liebe Ausländer, laßt uns mit diesen Deutschen nicht allein.“ Das liest sich zwar ganz nett, verkennt aber, daß es in erster Linie eine Aufgabe der deutschen Gesellschaft ist, sich mit diesem Problem zu befassen. Das läßt sich nicht von einer Seite allein lösen, dazu muß von beiden Seiten der Wille dazu vorhanden sein. Probleme lassen sich nicht lösen, wenn man die Augen fest zukneift. Ich erinnere an die Aussage, Deutschland sei kein Einwanderungsland, obwohl die Zahl der Ausländer, die in Deutschland arbeiteten und lebten, schon zu der Zeit nicht unerheblich war. Dagegen stand dann die Haltung, die Herkunft aus dem Ausland sei schon quasi ein Gütesiegel. Ich halte es da mehr mit Wolf Biermannn: Gute Freunde hab ich überall gefunden, doch eines das ist sonnenklar: Nirgends mangelt es an Schweinehunden.
Die Zuwanderung der sogenannten „Gastarbeiter“ war ja von beiden Seiten ein Experiment. Die deutsche Wirtschaft brauchte Arbeitskräfte, keine Zuwanderer und viele Ausländer betrachteten ihren Aufenthalt in Deutschland ebenfalls als eine befristete Angelegenheit. Beide Seiten haben sich gründlich geirrt. Wie Max Frisch es so treffend ausdrückte: Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen.